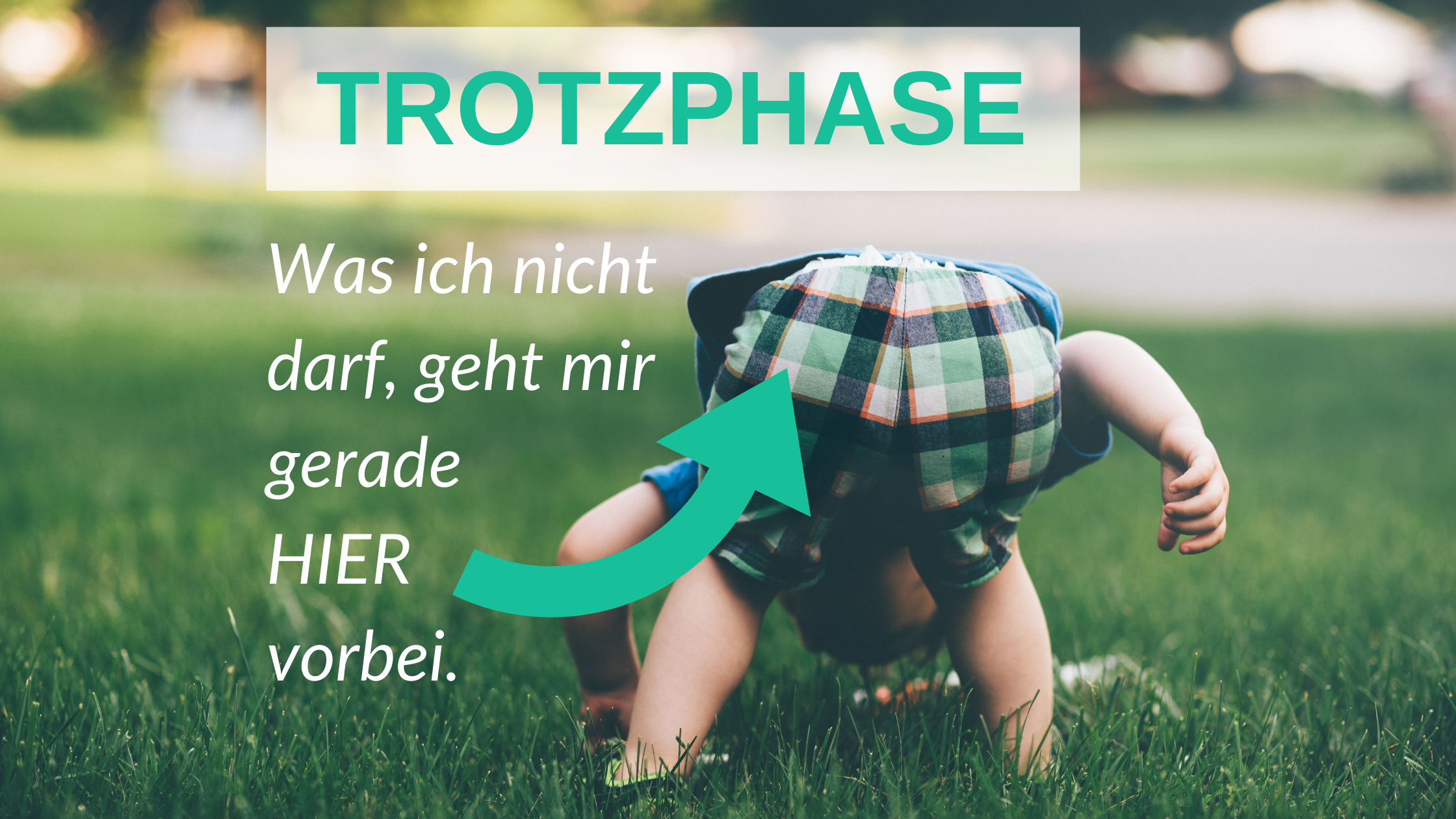Sie ist das Schreckgespenst aller jungen Eltern: Die Trotzphase. Berühmt-berüchtigt und quer durchs Land gefürchtet. Allein das Wort “Trotzphase” beschwört Kopfkino herauf: Das Kind, das sich im Supermarkt vor allen umstehenden Fremden auf den Boden wirft und mit Händen und Füßen strampelt, weil es keine Quengelware bekommt, ist schon ein Großstadtelternmythos. Ebenso wie die gut gemeinten, aber schlecht ankommenden Ratschläge der umstehenden Fremden, die dann auf das gepeinigte Elternteil einprasseln. Was können Eltern tun, um solche Szenen zu vermeiden?
“Trotzphase”: Was passiert da überhaupt mit unseren Kindern?
Zuerst einmal sollte man ein Kind in der Trotzphase besser verstehen lernen – also wissen, was in der sogenannten Trotzphase in Kindern vorgeht. In den ersten beiden Lebensjahren brauchen Babys und Kinder bei den meisten Tätigkeiten Hilfe: Beim Essen, beim Laufen lernen, beim Spielen und Klettern, sogar beim Einschlafen. Die Eltern sind ihre engsten Bezugspersonen, von deren Unterstützung Kinder in vielen Dingen abhängig sind. Mit dem Trotzalter ändert sich das: Kinder machen sich in dieser Phase ihrer Entwicklung ein Stück weit von ihren Eltern unabhängig. Weil es bei der Trotzphase um einen Abnabelungsprozess handelt, sprechen Entwicklungspsychologen auch von der “Autonomiephase” statt der “Trotzphase”.
Die Kleinen wollen nun vieles selbstständig machen – auch Dinge, die sie noch nicht schaffen können, weil ihnen beispielsweise motorische Fähigkeiten fehlen. Dieses “selbst wollen” ist aber notwendig für eine gesunde Kindesentwicklung – auch wenn es uns Eltern manchmal in den Wahnsinn treiben kann.
Besser verstehen: Was löst die Wutanfälle in der Trotzphase aus?
Zu den berüchtigten Wutanfällen kann das führen, wenn etwas nicht so klappt, wie das Kind es sich vorgestellt hat. Oder wenn etwas anders gemacht wird, als das Kind es gewohnt ist (z.B. wenn beim Essen nicht sein Lieblingsbecher auf dem Tisch steht). Oder wenn beim Spielen etwas anders läuft, als das Kind es wollte.
Das größte Problem: Die Zündschnur ist kurz. Sehr kleine Kleinkinder sind noch nicht in der Lage, in Krisensituationen (und solche uns banal erscheinenden Dinge können für Kinder Krisen sein) einen kühlen Kopf zu behalten und auf Kommunikation zu setzen. Dafür ist eine emotionale Reife nötig, die Kinder im Trotzalter einfach noch nicht haben. Sie werden in solchen Momenten sofort von Wut und Frustration überwältigt, die ihre Fähigkeit zu Sprechen scheinbar abschaltet. Und so haben wir Eltern oftmals noch nicht einmal die Möglichkeit, etwas zu korrigieren, um den Wutanfall aufzuhalten – er ist schon da, bevor wir überhaupt erfahren, was der Auslöser ist.
Dem Kind viel Freiraum lassen – aber nicht nur bei Wutanfällen
Wenn der Wutanfall erstmal da ist und das Kind von Frustration geschüttelt wird, ist es also sehr schwierig, es noch zu beruhigen. Oftmals müssen Eltern erstmal eine Weile hilflos zusehen, wie das Kind tobt, schreit und weint – und diese Hilflosigkeit frustriert wiederum uns Eltern.
Was helfen kann: Sich immer wieder klarzumachen, dass man damit nicht allein ist. Jedes Kind geht durch diese Phase, und die Eltern stets mit ihm. Möglicherweise hilft auch der Gedanke, dass das Kind sein Gefühl der Enttäuschung eben auf diese Art bewältigen muss – weil es noch keine anderen Strategien zum Frustabbau gelernt hat, weil es neuronal noch nicht dazu in der Lage ist. Kleinkinder können sich z.B. nicht selbst sagen “Das nächste Mal mache ich es besser” oder “Das nächste Mal bekomme ich ein Eis”, weil alles, was in der Zukunft liegt, für ihr Verständnis noch viel zu abstrakt ist. Als Kind leben wir schließlich viel mehr im Hier und Jetzt, als wir uns das als Erwachsene überhaupt noch vorstellen können!
Ich persönlich glaube, dass sich nicht alle Wutanfälle verhindern lassen – aber wenn man sich regelmäßig Zeit nimmt, in der das Kind seine Neugier ausleben kann, dann wird es in Situationen, die für uns Eltern stressig sind, vielleicht eher kooperieren. Das bedeutet, kurz zusammengefasst: Dem Kind möglichst viel erlauben und ihm ermöglichen, die Erfahrungen zu machen, für die es sich von sich aus interessiert – und das Kind dabei unterstützen. Die ‘Neins’ ganz gezielt für wichtige Situationen aufheben – damit sich das ‘Nein’ nicht abnutzt!
Fotocredit: Original Photo by Jordan Whitt on Unsplash